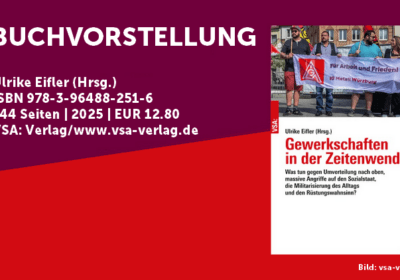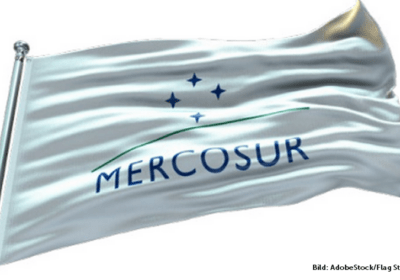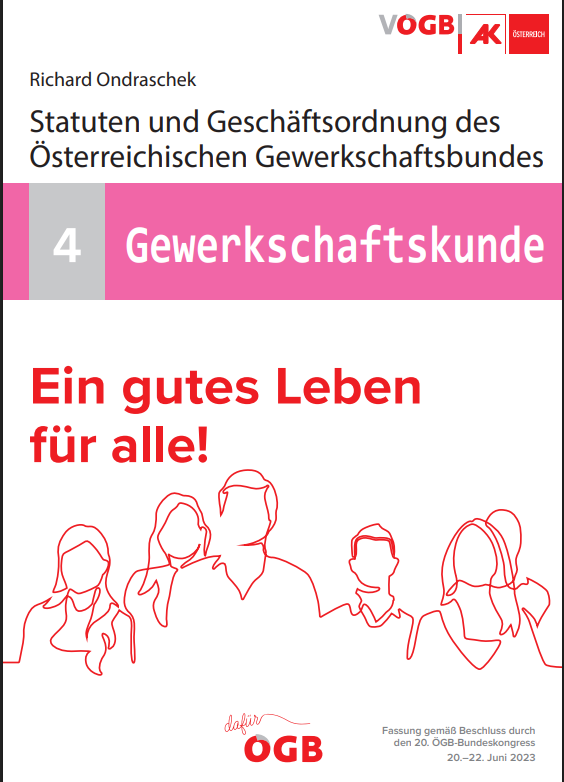
Verdrehte Wahrheit
Das Buch von Franz-Josef Lackinger, „Gewerkschaftskunde“ vom VÖGB ist eine Beschönigung der Geschichte des ÖGB. Er schreibt zum Oktoberstreik, dass die KPÖ die Unzufriedenheit ausnützen wollte, als sie 1950 versuchte, einen Generalstreik zu organisieren.
In Wirklichkeit wurde in Wien 1937 – also in der Zeit der großen Wirtschaftskrise – 54,6 kg Fleisch pro Jahr und pro Kopf verbraucht; 1950 waren es 35,9 kg Fleisch, nicht einmal zwei Drittel. Die Reallöhne lagen also tief unter denen der Vorkriegszeit. Doch es wurde nicht weniger produziert, sondern mehr. Die Industrieproduktion betrug 1950 schon 142,15 Prozent der Produktion von 1937. Und es wurde auch nicht weniger gearbeitet. Die Produktivität, die durch die Kriegszerstörung tief gesunken war, überschritt im November 1950 zum ersten mal mit 101,07 Prozent den Vorkriegszustand. Wenn trotzdem die Löhne so niedrig waren, so bedeutet das, dass der Anteil der Arbeiter am Sozialprodukt viel kleiner, der Anteil der Unternehmer viel größer war als in der Vorkriegszeit.
Oder grob gesagt: Während die Arbeiter sich sehr mangelhaft ernähren konnten, machten die Unternehmer gewaltige Profite. Die Unternehmerprofite aus der Produktion wurden ergänzt durch Überprofite aus der Sphäre der Güterverteilung, des Handels. Die Unternehmer waren also schon im Wirtschaftswunder, während die Arbeiter und Angestellten noch bei Erdäpfeln und „Getreideprodukten“ saßen. Aber man verlangte von Ihnen „Mäßigung“ oder gar neue „Opfer“ für den Wiederaufbau der Volkswirtschaft. Ihr Widerstand entsprang aus wirtschaftlichen Motiven und auch aus einem Gerechtigkeitsgefühl, das sich gegen neue Benachteiligungen empörte. Zum Generalstreikvorwurf ist zu sagen: Die KPÖ unterschätzte die Streikbereitschaft der Arbeiter. Der Streik war berechtigt, aber die Arbeiter wurden in ihrer verzweifelten Lebenssituation von ihrer führenden politischen Partei und der ÖGB-Führung im Stich gelassen.
Denn es war das Ziel der Regierung, so schnell wie möglich alle ökonomischen Eingriffe zu reduzieren und zur Marktwirtschaft zurückzukehren. Es bedeutete unter anderem auch den Verzicht auf eine sozialistische Politik. So wurden die Arbeiter in Streiks hineingetrieben, die sie ohne Gewerkschaftsführung nicht gewinnen konnten. Die ÖGB-Spitze hat vergessen, dass es auch darum ging, die „aufgeschobenen Forderungen“ von 1945 durch entschlossenen Kampf einzuklagen. Die Gewerkschaftsführung sprach aber 1950 von „einem Ast, auf dem wir alle sitzen“. Dieses einfache und falsche Bild von wirtschaftlichen Zusammenhängen konnte nur heißen, dass die ÖGB-Spitze meinte: Österreich habe sich dem allgemein herrschenden Profitsystem unterzuordnen.
Das konnte nur heißen, dass die Gewerkschaftsführung sämtliche noch so hohen Unternehmerforderungen und Maßnahmen akzeptieren würde – wenn auch unter radikalem Geschrei – weil sie nicht einmal gewillt war, die eigenen Forderungen mit den ihr möglichen Kampfmitteln durchzudrücken.
Beim Oktoberstreik 1950 waren Hunderttausende Menschen beteiligt. Die Arbeiter der größten Betriebe Österreichs standen in voller Einheit kürzere oder längere Zeit im Streik. Nach dem Streik wurden 85 führende Gewerkschafter aus dem ÖGB ausgeschlossen. Der Bundesvorstand des ÖGB billigte danach noch die Entlassung von Streikführern in den Betrieben. Am Ende kann man sagen: Das gesamte System beruhte mehr oder minder darauf, die Produktion zu steigern und die Höchstleistung zu erreichen. Dazu trugen nicht Aktionen der Massen bei, sondern einfache, von einer Funktionärsschicht verordnete Formeln. Wenn man dem folgt, geht man von einem Sachzwang in der Wirtschaft aus, ohne die Akteure hinter den Sachzwängen, die einem Bereicherungszwang unterliegen, zu sehen.
Werner Lang (Werkstatt für Literatur der Arbeitswelt)