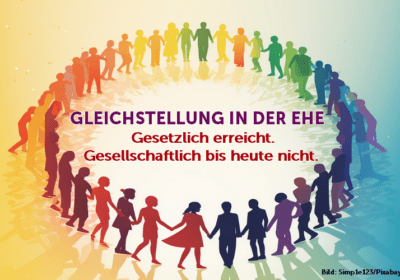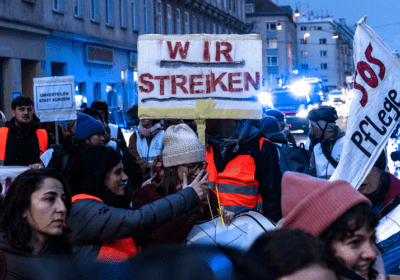Faul, asozial und sozialschmarotzend?
Österreich hat nach der Niederlande die höchste Teilzeitquote in der EU. Die zahlreichen Teilzeitbeschäftigten werden immer öfter öffentlich gemobbt – entweder “liebevoll” als Lifestyle-Beschäftigte bezeichnet oder ganz offen als faules, asoziales und sozialschmarotzendes Pack beschimpft. Weitgehend unberührt bleiben die strukturellen Probleme, die oft zur Teilzeitarbeit zwingen.
Ende Jänner dieses Jahres erklärte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl‑Leitner: „Ich gönne jedem, dass er seine Work-Life-Balance lebt, aber nicht auf unser aller Kosten. Wenn ein gesunder Mann oder eine gesunde Frau in Teilzeit arbeiten, ist das asozial.” Nach “Hannis Foul” setze der damalige Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher das “Fair(un)play” fort: Er verkündete, dass „bei Sozial- und Familienleistungen zu wenig unterschieden wird, ob jemand 20 oder 38 Stunden arbeitet. Wenn Menschen freiwillig weniger arbeiten, dann gibt es weniger Grund, Sozialleistungen zu zahlen.“
Ironischerweise kurz vor dem Equal Pensions Day am 7. August diesen Jahres ergänzte der neue Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer die leidige Debatte ”über die angeblich unsoziale Teilzeitarbeit”. Er wetterte, dass Teilzeitarbeit “zu attraktiv” sei und den Wohlstand und den Sozialstaat gefährde. Es brauche einen „Wake-up-Call“ zurück zur Vollzeit: “Lifestyle-Teilzeit ist weder solidarisch noch verantwortungsvoll, wenn sie zur gesellschaftlichen Norm wird.”
Lifestyle oder strukturelle Probleme?
Teilzeitarbeit hat in vielen Berufen nichts mit Lifestyle zu tun, sondern vielmehr mit strukturellen Zwängen, wie ein konservatives Familienbild, fehlende Kinderbetreuungsplätze, fehlende Vollzeitarbeitsplatzangebote oder gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen. Gerade Unternehmen in den von Frauen dominierten Branchen wie Pflege, Handel oder Gastronomie schreiben überdurchschnittlich viele offene Stellen ausschließlich in Teilzeit aus.
Auch “des AMS oberster Kopf” meldete sich in dieser unseligen Teilzeitdebatte zu Wort. Richtig ist für ihn, dass bei Frauen der Hauptgrund für Teilzeit in der mangelnden Kinderbetreuung liegt. Das ist antiquiert, unsinnig und gehört geändert, aber auch die Steuerbegünstigungen der “anderen Teilzeitbeschäftigten”. Für ihn sollte die Steuerprogression nicht am Monatseinkommen, sondern am Stundenlohn berechnet werden. Skurril wirkt, dass er öffentlich für mehr Vollzeitarbeitsplätze plädiert, aber in “seinem” AMS Arbeitslose per „Vertrag“ in Teilzeit-Arbeitsverhältnisse gedrängt werden. “Nimmt man so einen LmaA-Job nicht an, dann droht eine neunwöchige Bezugssperre”, kommentiert ein FB-Nutzerin.
Rechtsanspruch auf Vollzeit und Arbeitszeitverkürzung
Die Momentum-Institut-Chefin Barbara Blaha sieht in der Teilzeit weniger eine Krise der Leistungsbereitschaft, sondern eine Verteilung von Zeit, Sorge und Macht. Dabei verweist sie auf die beginnenden Kollektivvertragsverhandlungen, für die früh das Bild einer unproduktiven, weil nur halbtags tätigen Belegschaft aufgebaut werden soll, ebenso auf die historische Komponente, in der Arbeitnehmer:innen Arbeitszeitverkürzungen durchsetzen konnten: “Heute droht diese Verschiebung der Verhandlungsmacht erneut, das moralische Donnerwetter soll uns präventiv disziplinieren.”
Ehrenhalber erwähnt sei, dass die Sozialministerin Korinna Schumann den Blaha-Ansatz mit “einem Rechtsanspruch von unfreiwilliger Teilzeit auf Vollzeit zu wechseln” zumindest ein “Recht auf Mehrstunden” verlangt: “Es gibt 82.000 Frauen, die sich freuen würden, die gerne mehr Stunden oder Vollzeit arbeiten würden“.
Aber auf diesem Ohr sind ihre Regierungspartner:innen von ÖVP und NEOS taub. Auch von “ihrer Hausmacht”, dem ÖGB, kommt wenig Unterstützung. Es wird zwar rhetorisch Dampf abgelassen, aber weiter brav sozialpartnerschaftlich gebuckelt. Wann überwinden, die überwiegend sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer:innen, die ohnehin totgerittene Sozialpartnerschaft und erinnern sich an die klassenorientierte Mobilisierungs- und Kampfkraft ihrer Vorahn:innen.
Es braucht dringend einen allgemeinen Schritt zur Neuverteilung der Arbeit mit einer deutlich kürzeren Normalarbeitszeit für alle. Ein voller Lohn- und Personalausgleich dabei ist ohnehin nur ein Teil der Produktivitätsgewinne der Unternehmen seit der letzten allgemeinen Arbeitszeitverkürzung vor fünfzig Jahren. Ein Weg, den der Gewerkschaftliche Linksblock (GLB) im ÖGB, den Gewerkschaften und den Arbeiterkammern seit Jahren einfordert.
Josef Stingl