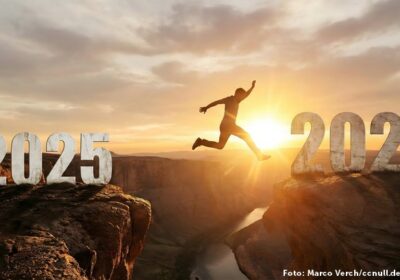Teilzeit besteuern? Der falsche Hebel
Die aktuelle Teilzeitdiskussion ist weniger eine arbeitsmarktpolitische als eine gesellschaftspolitische Auseinandersetzung – sie stigmatisiert vor allem Frauen, indem ihnen fehlender Einsatz unterstellt wird. Vier von fünf Teilzeitbeschäftigten sind weiblich. Sie reduzieren ihre Erwerbsarbeitszeit nicht aus „Lifestyle“-Gründen, sondern weil sie noch immer einen erheblichen Teil unbezahlter Pflege- und Sorgearbeit leisten. Nicht freiwillig, sondern gezwungenermaßen: Drei Viertel aller Teilzeitkräfte reduzieren ihre Arbeitszeit, weil die Lebensumstände es erfordern. Wer Kinder betreut, Angehörige pflegt oder beides gleichzeitig stemmt, arbeitet am Ende häufig sogar mehr Stunden als viele Männer – nur eben in anderen Bereichen.
Trotzdem geraten Teilzeitkräfte ins Visier wirtschaftsliberaler Politiker:innen und Ökonom:innen. Von Ministern bis hin zu Think Tanks werden sie als Gefahr für den Sozialstaat gebrandmarkt. Die zentrale Botschaft lautet: Teilzeit sei ein Luxus, den sich die Gesellschaft nicht mehr leisten könne.
Steuerpolitik als falsches Allheilmittel
Als Lösung wird ein Umbau des Steuer- und Abgabensystems propagiert. Doch das greift nicht die Ursachen von Teilzeit auf, sondern verschärft nur die Symptome. Wer Kinderbetreuung nicht leistbar macht, ungenügende Pflegestrukturen vernachlässigt oder das Problem weniger altersgerechter Arbeitsplätze ausspart, kann mit Steuergesetzen keine nachhaltige Trendwende herbeiführen.
Ein Beispiel: Die viel diskutierte „Flat Tax“. Mit ihr würde die Steuerprogression – ein Grundpfeiler unseres Systems – abgeschafft. Wer viel verdient, müsste relativ weniger beitragen, wer wenig verdient, relativ mehr. Ein niedriger Einheitssatz würde ein Loch in die Staatseinnahmen reißen. Ein höherer Satz wiederum würde gerade jene treffen, die Teilzeit arbeiten, und auch viele Vollzeitkräfte, deren Einkommen schlicht nicht hoch ist. Vollzeit heißt nicht automatisch „Gutverdiener:in“. Jede Änderung am Steuersystem betrifft alle Beschäftigten – nicht nur jene in Teilzeit.
Noch absurder wird es beim Vorschlag einer Besteuerung auf Stundenlohnbasis. Zwei Menschen mit identischem Monatsgehalt würden unterschiedlich behandelt, nur weil sie eine unterschiedliche Zahl an Stunden arbeiten. Die Person mit höherem Stundenlohn wäre steuerlich bessergestellt – eine Einladung zu Ungerechtigkeiten und Missbrauch. Arbeitgeber und Beschäftigte könnten versucht sein, Arbeitsstunden künstlich aufzublähen, um steuerliche Vorteile zu erzielen.
Ein weiterer Vorschlag ist ein „Teilzeit-Malus“ in der Sozialversicherung: ein Mindestbeitrag auf Vollzeitniveau. Das würde all jene bestrafen, die tatsächlich nur wenige Stunden arbeiten können – sei es aus gesundheitlichen Gründen oder wegen Betreuungspflichten. Damit würde ein zentrales Prinzip unseres Sozialstaats ausgehebelt: gleiche Leistungen für alle, unabhängig vom Einkommen. Wenn an diesem Prinzip einmal gerüttelt wird, öffnen sich Türen für Angriffe auf weitere Gruppen – Arbeitslose, Pensionist:innen, Kranke, Menschen mit Behinderung.
Risiken für den Arbeitsmarkt
Gemeinsam ist all diesen Ideen, dass sie das Arbeitsvolumen nicht erhöhen, sondern im schlimmsten Fall reduzieren. Historisch betrachtet war die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten, ein entscheidender Treiber für die steigende Erwerbstätigkeit von Frauen. In den letzten 50 Jahren hat sich die Zahl unselbständig beschäftigter Frauen mehr als verdoppelt. Würden Teilzeitkräfte nun steuerlich benachteiligt, könnte ein erheblicher Teil dieser Gruppe wieder aus dem Arbeitsmarkt gedrängt werden – ein Rückschritt in Fragen der Gleichstellung.
Die Debatte krankt zudem an einem Widerspruch: Wenn Vollzeit angeblich so unattraktiv geworden ist, warum arbeiten dann immer noch rund zwei Drittel aller Beschäftigten Vollzeit? Wären steuerliche Fehlanreize tatsächlich der Hauptgrund für Teilzeit, müssten sich diese längst in massenhaften Arbeitszeitreduktionen niederschlagen. Die Realität spricht dagegen.
Besonders bezeichnend ist auch, dass die unfreiwillig in Teilzeit arbeitenden Menschen kaum Beachtung finden. Zehntausende Beschäftigte würden gerne mehr Stunden leisten, können es aber nicht, weil Arbeitgeber keine Vollzeitstellen anbieten. Statt diese Missstände zu beheben, schiebt man die Verantwortung auf jene, die sich für Teilzeit entscheiden. Ein Recht auf Mehrarbeit wäre ein naheliegender erster Schritt – doch genau das wird von liberaler Seite nicht gefordert.
Teilzeit als legitime Entscheidung
Am Ende geht es nicht nur um ökonomische Fragen, sondern um gesellschaftspolitische Grundsätze. In einer liberalen Demokratie muss es legitim sein, freiwillig in Teilzeit zu arbeiten, wenn man es sich leisten kann. Und wer stellt bitte fest, wann Teilzeit legitim ist und wann nicht – Soll dafür ernsthaft eine Art ‚Teilzeitkommission‘ entscheiden?
Teilzeit ist kein Luxusproblem, sondern spiegelt die Realität vieler Menschen wider – insbesondere von Frauen, die Erwerbs- und Sorgearbeit miteinander vereinbaren. Wer Teilzeit über das Steuer- oder Abgabensystem bestrafen will, riskiert nicht nur mehr Ungleichheit, sondern auch eine Schwächung der Erwerbsbeteiligung. Das wäre ein Rückschritt für Gesellschaft, Wirtschaft und Sozialstaat gleichermaßen.
Helene Schuberth (Bundesgeschäftsführerin des ÖGB für den Bereich Grundlagen und Interessenpolitik)