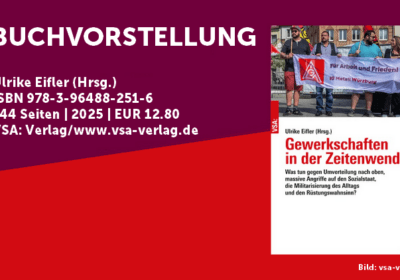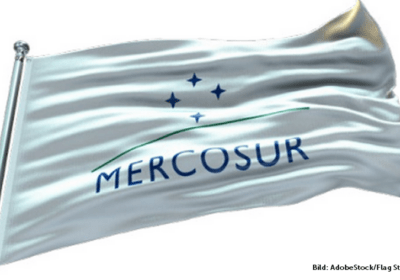Die ökonomischen Rahmenbedingungen, die uns derzeit beschäftigen
Österreich befindet sich das dritte Jahr in Folge in einer Rezession. Die Industrieproduktion ist eingebrochen, die Teuerung macht vielen noch zu schaffen. Das Budgetdefizit ist stark angestiegen, während wieder strenge EU-Fiskalregeln gelten. Die wirtschaftspolitischen Handlungsspielräume werden dadurch stark eingeschränkt – gleichzeitig besteht dringender Investitionsbedarf in die sozial-ökologische Transformation. Steigende Militärausgaben drohen die Prioritäten weiter zu verschieben.
Autorin: Angela Pfister (ÖGB-Expertin für Volkswirtschaft), Foto: unsplash
Die Vorgängerregierung hat in der Inflations- und Energiekrise sinnvolle Antworten vermissen lassen: Mit der Senkung der Körperschaftssteuer sowie überbordenden Förderungen gab es teure Geschenke an Konzerne. Anstatt mit gezielten Preiseingriffen die Inflation zu bekämpfen, setzte die Regierung zudem auf Einmalzahlungen, die weitgehend verpufften.
Letztlich hat all das zu einem massiven Budgetdefizit geführt, das nun – mit der Wiedereinsetzung der europäischen Fiskalregeln im Jahr 2024 – abgebaut werden muss. Staaten mit hoher Verschuldung oder übermäßigem Defizit müssen einen sogenannten Fiskalstrukturplan vorlegen, um Schritt für Schritt wieder in Richtung eines ausgeglichenen Haushalts zu kommen. Österreich liegt im Jahr 2024 mit einer Defizitquote von 4,7 Prozent und einer Schuldenquote von 81,8 Prozent deutlich außerhalb des erlaubten Rahmens. Diesen historisch hohen Konsolidierungsbedarf will die neue Regierung mit einem Sparkurs beginnend mit dem Doppelbudget 2025/2026 erfüllen.
Der Weg aus dem Budgetdefizit ist nicht einfach
Der Investitionsbedarf in Infrastruktur, Gesundheit und Pflege, besserer Bildung und Arbeitsmarkt ist enorm. Ein radikaler Sparkurs, wie von manchen gefordert, würde nicht nur den prognostizierten Aufschwung, sondern die soziale Sicherheit gefährden. Ein Lichtblick ist, dass mit dem aktuellen Doppelbudget breite Schultern z.B. Energieunternehmen und Banken höhere Beiträge leisten. Ebenso sind etliche Offensivmaßnahmen wie etwa die Aktion 55 plus für Langzeitarbeitslose oder das verpflichtende zweite Kindergartenjahr enthalten.
Aber das reicht nicht aus. Wer es mit einer gerechten Verteilung der Krisenlast ernst meint, kommt an einer stärkeren Beteiligung großer Unternehmen mit Rekordgewinnen und Vermögenden nicht vorbei. Es braucht daher eine ernsthafte Diskussion über eine Vermögens- und Erbschaftssteuer sowie eine Rücknahme der Körperschaftsteuersenkung.
Aber ganz Europa steht wegen geopolitischen Spannungen und der Zollpolitik Trumps unter Druck. Die Antwort der EU sind Investitionen in eine militärische Aufrüstung, die auch strukturelle wirtschaftliche Probleme lösen sollen. Wer meint, Europa könnte durch mehr Waffen die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen lösen, irrt jedoch. Denn Investitionen in Panzer bringen keine Fachkräfte, kein leistbares Wohnen und keine emissionsfreie Industrie.
Bei den Militärausgaben werden die EU-Fiskalregeln flexibel
Es ist jedenfalls höchste Zeit, die europäischen Fiskalregeln zu überdenken, um Spielraum für eine nachhaltige und soziale Wirtschaftspolitik zu schaffen. Aber eine Sonderbehandlung militärischer Ausgaben wird letztlich früher oder später dazu führen, dass nationale Haushalte an anderer Stelle kürzen werden müssen, um die steigenden Verteidigungskosten zu decken, wie die EU-Kommission selbst schon einräumte.
Ein weiteres Problem liegt in der chronischen Vernachlässigung der Binnennachfrage. Jahrzehntelang haben europäische Staaten auf Exporterfolge gesetzt. Doch das greift zu kurz: Nur rund zwölf Prozent der hierzulande produzierten Waren und Dienstleistungen werden im EU-Ausland nachgefragt. Es ist also schlicht ökonomisch vernünftig, die inländische Nachfrage zu stärken, um Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung zu sichern. Eine aktive Steuerung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage – durch Investitionen, faire Löhne und soziale Sicherheit – ist der sinnvollere Weg, als einseitig auf Export und Wettbewerbsfähigkeit zu setzen.
Die Globalisierung der letzten Jahrzehnte hat ihre Schattenseiten offengelegt. Neoliberaler Freihandel führte zu wachsender Ungleichheit, Standortverlagerungen und steigenden Abhängigkeiten. Die Produktion wanderte dorthin, wo Löhne niedrig und Umweltstandards schwach sind – zum Nachteil von Beschäftigten, Regionen und dem Klima. Die COVID-Pandemie, zunehmende Konfrontationen auf globaler Ebene und zuletzt Trumps Zollpolitik sollten die EU-Kommission längst zum Umdenken bewegen. Europa muss den Binnenmarkt stärken, strategische Produktionsketten stärken und aufbauen sowie in die sozial-ökologische Transformation investieren. Eine Industrie- und Handelspolitik muss auf fairen Wettbewerb, gute Arbeitsplätze und nachhaltige Wertschöpfung in Europa setzen – nicht auf den billigsten Preis weltweit.