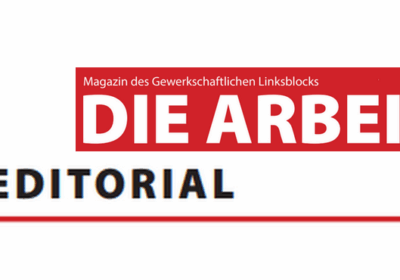Türöffner für Autoritäre
Der Neoliberalismus sei eine „marktwirtschaftlich freie Wirtschaftsordnung“, in der Eingriffe des Staates „auf ein Minimum beschränkt sein“ sollen und auf die „Selbststeuerung der Marktwirtschaft“ gesetzt wird. So simpel wird uns „Im Sprachlabor“ die Welt erklärt (Presse, 9.11.2024).
Die alltägliche Praxis zeigt uns allerdings, dass der Neoliberalismus den „sozialen Ausgleich“ als ein lästiges Hindernis sieht, das es zu beseitigen gilt. „Monopole und Kartelle verhindern“ ist ein Wunschtraum – hat der seit den 1970er Jahren ins liberale Extrem gesteigerte Kapitalismus doch zu einer bisher nicht gekannten Konzentration des Kapitals geführt. Der Staat wird als Hemmnis empfunden – außer er dient dazu für die Konzerne günstige Gesetze zu schaffen und in Krisenfällen mit Milliardenhilfe aus Steuergeldern Banken und Konzerne zu retten.
Diese neoliberale Ideologie wird insbesondere von Parteien wie den NEOS, der ÖVP und der FPÖ vertreten, sie gilt – insbesondere in Kombination mit der „liberalen Demokratie“ – jedoch als politische Grundlage von Sozialdemokratie und Grünen. Umso größer ist das Entsetzen gerade der Letzteren, wenn als Ergebnis autoritäre bis neofaschistische Kräfte immer stärker werden, wie dies mit der Wahl der FPÖ in Österreich oder von Trump in den USA erfolgt ist.
Die Wirtschaftssoziologin Valentina Ausserladscheider (Uni Wien) zeigt nun aber in ihrem Buch „Far-Right Populism and the Making of the Exclusionary Neoliberal State“, dass „der Neoliberalismus mitgeholfen hat, eine rechte Regierungsbeteiligung gesellschaftsfähig zu machen“. Denn gerade der neoliberale Extremismus hat – in Verbindung mit der als Dogma gepredigten Globalisierung und der Beseitigung möglichst aller Schranken für Handel und Kapitaltransfer – zu massiven gesellschaftlichen Verwerfungen geführt. Nämlich indem eine kleine Minderheit immer reicher und mächtiger wird, während die hemmungslose Konkurrenz – in Kombination mit der Zerstörung des Sozialstaates und der Privatisierung öffentlichen Eigen- tums – zu massiver sozialer Verun- sicherung und gesellschaftlicher Ent- solidarisierung führt.
Recht anschaulich bestätigt sich dies mit dem Aufstieg der FPÖ zur stärksten Partei bei der Nationalratswahl 2024. Laut Ausserladscheider hat nämlich gerade die Kickl-Partei die „Denkrichtung des Neoliberalismus wie er schon unter Thatcher in Großbritannien und in den USA unter Reagan schon in den 1980er Jahren entwickelt wurde in den Parteienwettbewerb integriert. Schon 1983 hatte der damalige FPÖ-Chef Norbert Steger die Kombination von „starken Staat“ und „freiem Markt“ im Programm und die FPÖ arbeitete daran salonfähig zu werden, die „2000er Regierung hat den Normalisierungs- trend gesetzt“.
Das Ergebnis ist, dass „der Neoliberalismus trotzdem sehr nationalistisch sein kann, wenn er durch rechtsradikale Akteure gefördert wird“, so die Studie: „Die Abspaltung des Liberalen Forums von der FPÖ 1993 zeigt, dass die nationalistische Fraktion in der FPÖ gewonnen hat.“ Der Hardcore- Neoliberalismus der NEOS als Nach- folger des LIF verdeutlicht das.
Der deutsche Publizist Raul Zelik fragt daher – nicht nur zur Wahl von Trump als US-Präsident – zu Recht: „Wie viel Sinn macht es eigentlich, den liberalen Kapitalismus gegen den Faschismus zu verteidigen, wenn es der liberale Kapitalismus selbst ist, der den Faschismus hervorbringt?“